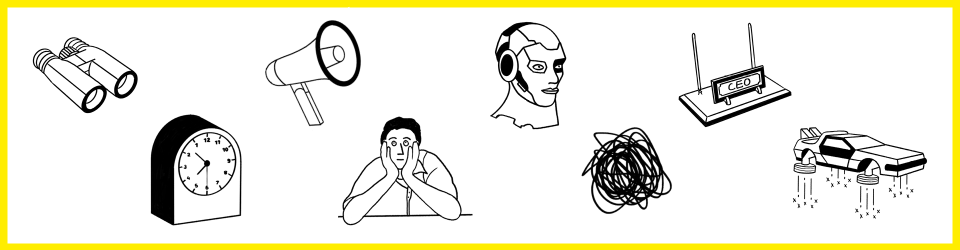„Noch nie war so viel Zukunft wie jetzt“
Der Chef des Zukunftsinstituts, Harry Gatterer, über den Umgang mit der Corona-Pandemie und die Lehren, die Manager und Politiker, Mitarbeiter und Bürger daraus ziehen können.
22.05.2020, Interview mit Harry Gatterer / Zukunftsinstitut; geführt von Michael Hasenpusch

Harry Gatterer
Trend- und Zukunftsforscher sowie Geschäftsführer des Zukunftsinstituts
Herr Gatterer, viele Menschen erleben diese Zeit als eine Zäsur und glauben, dass am Ende nichts mehr so sein wird wie vorher? Woher kommt diese Gewissheit in so ungewissen Zeiten?
Die Corona-Pandemie hat die Zukunft massiv verändert in dem Sinne, dass sie immer eine Vorstellung davon ist, wie die Welt sein könnte, indem wir das Bestehende fortschreiben. Jetzt hat sich der Alltag extrem verändert und die Fortschreibung des Gewohnten funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig war noch nie so viel Zukunft wie jetzt, denn alle tun ständig etwas, was sie sonst nicht so oft tun. Sie fragen sich: Wie geht’s weiter?
Mitte März haben Sie vier Zukunftsszenarien veröffentlicht, von denen drei relativ pessimistisch sind und eines optimistisch ist. Wo stehen wir jetzt, einige Wochen später?
Für diese langfristig angelegten Szenarien sind noch keine Trends erkennbar. Es fehlen dafür zum einen noch Daten, beispielsweise für die Konjunktur im April. Zum anderen würden solche punktuellen Daten aber auch einen ganz wichtigen Aspekt nicht zeigen, nämlich den der Verbindungen dieser Daten untereinander. Diese Konnektivität war uns bei unseren Szenarien besonders wichtig, und damit die Frage: Was lässt sich einfach wiederherstellen und was nicht. Viele komplexe Zulieferketten existieren nicht mehr und lassen sich auch nicht so einfach wieder anschalten. Deshalb sollten sich Manager und Politiker im Moment nicht darauf konzentrieren, was geht, und sich dabei auf Daten verlassen, die das Vergangene beschreiben, sondern darauf, was in Zukunft gewollt ist.
Hängt das eine nicht vom anderen ab?
Zukunft hat nicht nur mit Können, sondern auch viel mit Wollen zu tun. Jeder sollte sich nicht nur fragen, was aufgrund bisheriger Erfahrungen möglich ist oder was nicht, sondern eine Vorstellung für das morgen entwickeln. Entscheidend wird sein, dass aus der Krise eine konstruktive Idee entsteht, die in den nächsten Monaten an Fahrt gewinnt. Das gilt gesamtgesellschaftlich für Deutschland und Europa, aber auch für Unternehmen – und im Prinzip für jeden Einzelnen.
Entscheidend wird sein, dass aus der Krise eine konstruktive Idee entsteht, die in den nächsten Monaten an Fahrt gewinnt. Das gilt gesamtgesellschaftlich für Deutschland und Europa, aber auch für Unternehmen – und im Prinzip für jeden Einzelnen.
Man sollte einer ungewissen Zukunft also mit einem guten Plan begegnen?
Auf jeden Fall. Als Mensch und als Unternehmen ist es in solchen Ausnahmesituationen wichtig, sich über seine eigene Identität klar zu sein und über die Rolle, die man in Wirtschaft und Gesellschaft spielt oder spielen will. Eine klare Identität bringt in jedem Fall Stabilität mit sich. Gleichzeitig müssen wir damit leben, dass unsere Pläne auf der Grundlage von sehr ungenauen Daten basieren. Man muss in der Lage sein, aus den Bruchstücken, die wir heute kennen, ein Bild der Zukunft zu entwerfen und dieses zu operationalisieren, also zu fragen, was getan werden muss, um dorthin zu kommen.
Mit der Pandemie ist jeder von uns ein Zukunftsforscher geworden und studiert täglich Prognosen. Nützt das bei der Bewältigung der Situation?
Wir erleben derzeit eine Prognose-Show mit der großen Schwäche, dass Prognosen immer auf Daten und Modellen beruhen und wir derzeit nichts Funktionierendes haben. Die Zahlen, die wir täglich sehr professionell aufbereitet präsentiert bekommen, sehen zwar schön aus, sagen aber wenig. Dass uns in dieser Situation das Fundamentalwissen fehlt, ist völlig normal. Nicht normal ist allerdings, dass wir das täglich im Fernsehen vorgeführt bekommen. Deshalb sollte jeder diese Zahlen zur Kenntnis nehmen, sie aber nicht dazu nutzen, einfache Rückschlüsse abzuleiten, sondern um systemische Zusammenhänge zu erkennen. Solche Prognosen sollten die Grundlage sein für „Was-wäre-wenn-Szenarien“, die viel bessere Entscheidungen ermöglichen als singuläre Zahlen mit fragwürdigem Wahrheitsgehalt.
In solchen Zeiten sind mehr denn je Entscheider in Politik und Wirtschaft gefragt. Welche Eigenschaften sollten sie heute ganz besonders vorweisen können?
Wir stehen an einer Weggabelung zweier massiv unterschiedlicher Führungsstile. Beim einen behauptet ein Dominator, Bescheid zu wissen, bietet einfache Lösungen und drückt sie mit aller Macht durch. Dieses alte Spiel beobachten wir gerade bei führenden Politikern in Ungarn und einem Teil der Bevölkerung, der das gut findet. Erfahrungsgemäß trägt dieser Stil nicht lange. Wir werden aber auch Führungspersönlichkeiten erleben, die in die Komplexität hineingehen, die ein Lernen nicht nur zulassen, sondern offen zur Maxime erklären. Solche Persönlichkeiten zeigen, dass sie ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten getroffen haben. Sie stellen dabei keinen Absolutheitsanspruch, sondern binden Mitarbeiter ein, die sonst nicht gefragt werden würden, führen Feedback-Loops ein und sorgen für Transparenz im Entscheidungsprozess. Das ist im Vergleich zur alten Dominanz-Methode der langsamere und anstrengendere, aber auch der nachhaltigere Weg, denn er stärkt das System.
Dafür braucht man mündige Mitarbeiter und mündige Bürger.
Richtig, deshalb zeigen Krisenzeiten immer, welche Kultur in einem Unternehmen oder einer Gesellschaft in den Jahren davor gepflegt wurde. In der Krise kann man solche Verhaltensweisen nicht einfach aus dem Hut zaubern. Es muss schon vorher eine Kultur existieren, die den Mut, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen, belohnt und nicht bestraft. Ein Beispiel für mich ist aktuell Volkswagen, die nach der Dieselkrise intern viel dafür getan haben, die bis dahin herrschende Angstkultur im Unternehmen zu verändern. Insofern hat die Dieselkrise von 2015 viel dazu beigetragen, dass das Unternehmen trotz der großen aktuellen Probleme für Fahrzeugbauer, gut dasteht.
Was bedeutet die Corona-Pandemie für unseren Umgang mit dem Klimawandel? Können Erfahrungen mit der einen Krise auf eine andere übertragen werden?
Eindeutig: ja. Wenn Organisationen und Gesellschaften weltweit diese Krise überwunden haben, werden sie gestärkt daraus hervorgehen. Diese langfristig positive Erfahrung wird ein Vorteil sein, wenn es um die Klimakrise geht. Die Klimakrise ist uns zwar nicht so nahe, denn es kommt nicht der Alltag zum Erliegen, so wie das jetzt der Fall ist. Aber die Erfahrung, das überwunden zu haben, wird uns im Denken und Handeln und Vorausplanen dabei helfen und uns alle krisenresilienter machen.
Der Artikel erschien ursprünglich 2020 in der perspectives #7, Themen-Special: Schöne neue Welt
Bildquelle Stage: DennerleinBrands GmbH