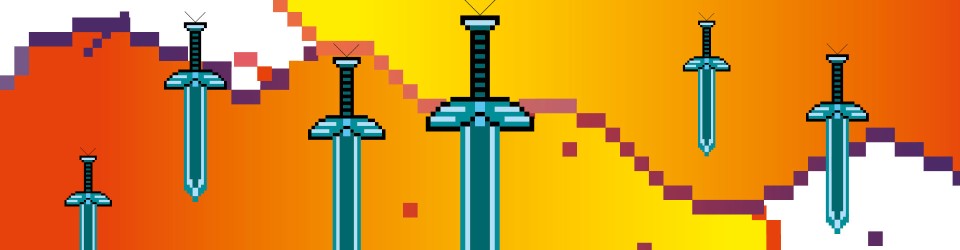„Wir erleben einen digitalen Darwinismus“
Sie steht ganz oben auf der politischen Agenda. Kaum ein Unternehmen, das nicht ihre große Bedeutung betont – und doch schwebt sie wie ein Damoklesschwert über Deutschland: Die Digitalisierung. Wie sehr sie die Zukunft der Arbeit verändert, zeigen die Ergebnisse einer global durchgeführten Delphi-Studie. Dr. Ole Wintermann hat für die Bertelsmann Stiftung die Ergebnisse für Deutschland analysiert.
01.06.2018, Interview mit Dr. Ole Wintermann, Bertelsmann Stiftung, geführt von Christiane Zimmer

Dr. Ole Wintermann
Senior Projektmanager, Programm Unternehmen in der Gesellschaft der Bertelsmann Stiftung
Herr Wintermann, Sie sagen, dass Deutschland ein digitales Entwicklungsland ist. Dabei haben Politik und Wirtschaft die Digitalisierung doch ganz oben auf ihre Agenda gesetzt. Warum will es mit der digitalen Transformation nicht klappen?
Das Problem mit der Digitalisierung in Deutschland ist zweidimensional. Zum einen mangelt es uns immer noch an einer geeigneten Technik. Deutschland steht beim Ausbau der Breitband- und Glasfasertechnik hinter manch einem ökonomischen Entwicklungsland. Zum anderen mangelt es an der Kenntnis. Unsere Bildungsstruktur ist nicht auf Digitalisierung ausgerichtet. Noch weiter vom digitalen Gedanken entfernt ist jedoch die Kultur. Und die können wir nicht einfach kaufen. Ich will ein Beispiel geben: In vielen Unternehmen sind mittlerweile Kollaborations-Tools vorhanden. Aber sie werden nicht als solche genutzt, sondern als Datenarchive. Die Technik ist da, aber wir sind nicht in der Lage mit den Tools zu kommunizieren. Deshalb sind wir ein digitales Entwicklungsland.
In der Denkfabrik Millennium Project wird fortlaufend eine globale Delphi-Studie zur Zukunft der Arbeit 2050 herausgebracht. Sie begleiten für die Bertelsmann Stiftung die Studie. Wie arbeiten wir in der digitalen Zukunft oder besser gesagt, wie nicht?
Die Studie ist die erste ihrer Art, die Experten aus aller Welt einbindet, um eine globale Sicht auf das Thema Arbeiten in der Zukunft zu bekommen. Bislang gab es unterschiedliche Schätzungen darüber, wer in Zukunft von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. Die einen sagen, nur die Geringverdiener, andere sagen, dass sich neue Arbeitsplätze generieren werden. Aber da ist viel Kaffeesatzleserei dabei. Die Studie wirft einen weiten Blick in die Zukunft. Dabei geht es nicht um finale Antworten, sondern um die Diskussion heute, damit wir die Zukunft von morgen nachhaltig gestalten können.Demnach könnte die globale Arbeitslosigkeit im Jahr 2050 auf 24 Prozent ansteigen. Was kann also die Lösung sein? Dreiviertel der Befragten sagen, das Entscheidende sei ein Bedingungsloses Grundeinkommen.
Ein Grundeinkommen deshalb, weil die Roboter uns die Arbeit nehmen?
Es ist klar, dass die menschliche Intelligenz langfristig gegenüber der künstlichen Intelligenz nicht mithalten kann, wenn es um die Arbeitsleistung geht. Den Fakt zu negieren wäre falsch. Weltweit gibt es zwei Fraktionen: Die einen sagen, die künstliche Intelligenz wird uns vernichten. Die anderen sagen, wir können das Paradies auf Erden erreichen, wenn wir uns die künstliche Intelligenz zu nutzen machen.
Egal wie, Arbeiten wird nicht mehr so sein, wie wir es heute kennen.
Ja. Heute denken wir beim Thema Arbeit lokal und auch immobil. Wir erlernen einen Beruf, treten eine Stelle an, die uns an einen lokalen Arbeitsplatz bindet – von Arbeitsreisen oder Homeoffice abgesehen. Morgen wird der erlernte Beruf nicht mehr entscheidend sein und auch nicht unser Schreibtisch im Büro. Arbeiten erfolgt mobil und virtuell, quasi auf einer Metaebene. Es geht nicht darum, wo der Arbeitgeber lokalisiert ist. Dementsprechend sind auch nationale Arbeits- wie auch Arbeitssicherungssysteme überholt.
Gleiches gilt für das Thema Bildung. Lebenslanges Lernen klingt nach einer Verpflichtung. Es ist aber eine Chance. Lernen ist auch nicht an das Gebäude Schule oder Uni gebunden und hat als Währung ein Zertifikat. Wir reden künftig von selbstgesteuerter Entwicklung. Da ist das Zertifikat aus der Schule für mich nicht mehr relevant.
Damit gehören Zeugnisse und Zertifikate der Vergangenheit an. Wie qualifiziert man sich dann?
Es geht um das informelle Lernen. Diese Option gibt es ja auch heute schon. Sie ist aber in der Arbeitswelt überhaupt noch nicht angekommen. Ich kann mir 20 Management-Tutorials auf YouTube ansehen und anschließend in einen Wettbewerb mit einem traditionellen MBA’ler eintreten. Wir müssen endlich lernen, das Thema Digitalisierung nicht allein stehen zu lassen, sondern es in den Kontext von Alterung, Migrationsströmen, Klima und eben Arbeitsbedingungen zu setzen. Wir müssen lernen in Kontexten zu denken.
In der Studie sprechen Sie von einer Transformationsphase über ein bis zwei Dekaden. Klingt, als hätten wir genügend Zeit, um uns an eine neue Art zu Arbeiten zu gewöhnen.
Bei der Umgestaltung des Bildungssystems und der Infrastruktur sind 20 Jahre kein langer Zeitraum. Deutschland muss sich jetzt einstellen. Der Ausbau an Glasfasernetzen ist zwingend notwendig. Ebenso wichtig ist ein Wandel unserer Kulturvorstellungen. Deutschland lebt in der Tradition des Buchdrucks und seiner Qualitätsmedien. Das gedruckte Wort steht für Verlässlichkeit. Das Internet als Informationsmedium hingegen wird gerade in der älteren Generation immer noch kritisch betrachtet.
Tun sich deshalb auch die deutschen Unternehmen so schwer mit dem Wandel in ein neues Arbeitszeitalter?
Ja, das ist ein Aspekt. Die Generation der Unternehmenslenker lebt noch in der Informationswelt.
Wir leben in verschiedenen Realitäten. Nicht umsonst gibt es in den Unternehmen heute so viele Schatten-IT‘s. Da wären wir wieder bei dem Thema Kollaborations-Tools, die als Datenarchive verstanden werden.
Wie könnte ein Szenario für ein Wirtschafts- und Sozialsystem 2050 aussehen? Arbeitet der Mensch noch selbst? Oder ist die künstliche Intelligenz an seine Stelle getreten und macht ihn überflüssig?
Wir können natürlich die Zukunft nicht vorhersagen. Dennoch ist eines ist klar. Wir dürfen nur noch auf europäischer Ebene denken. Die Lösung liegt in Europa nicht in Deutschland. Wir sind heute schon irrelevant. Und auch Europa wird bald nur noch vier Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.
Auch beim Thema Arbeiten erleben wir einen Paradigmenwechsel. Heute fragen wir uns: Wie können wir arbeiten, wenn die Künstliche Intelligenz doch unsere Arbeit macht? Besser sollten wir uns fragen: Wie wollen wir unsere Freizeit gestalten, denn die Künstliche Intelligenz übernimmt ja unsere Arbeit. Wenn das Grundeinkommen die Lösung ist, bedeutet dies auch ein neues Denken über den Wert der Arbeit.
Aber wo bleibt dann der Mensch? Laut der Studie gehört die Zukunft den Individuen und nicht den großen Systemen. Wie müssen sich Unternehmen wandeln, damit sie positiv in die Zukunft blicken können?
Wir haben sechs Baustellen identifiziert:
- Die Neuaufstellung der externen Arbeitsorganisation: von einer pyramidalen Steuerung zu einer Holakratisierung und einem agilen Projektmanagement.
- Die Ebene Arbeitnehmer: Berufe werden unwichtiger, Tätigkeit werden wichtiger. Wir erleben den digitalen Darwinismus. Formale Bildung versus informelle Bildung. Es gilt neue Karrierewege für Mitarbeiter auf temporärer und horizontaler Ebene zu definieren.
- Dafür muss sich unser Arbeitsrecht auf einer stärker individuellen und kollektiven Ebene verändern. Doch diese Baustelle, kann nur mit den Tarifpartnern verändert werden.
- Das tradierte Führungsverständnis. Es geht um das Coaching der Mitarbeiter, nicht Command-and-Control. Das Rollenverständnis gehört der Vergangenheit an. Zudem kann mit einer defizitären digitalen Kompetenz keine Innovation erfolgen.
- Die Unternehmenskultur: Das Modell der Schornsteinkarrieren, durch die man nach oben kommen will, ist künftig nicht entscheidend.
- Zuletzt die Technologie: Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe. Die Nutzung von digitalen Messengern, Networking Tools und Chats ist gelebte Realität. Sie müssen endlich anerkannt werden.
Deutschland ist für seinen Ingenieurs- und Pioniergeist bekannt. Ingenieure dominieren die deutsche Wirtschaft. Sie haben aber ein anderes Verständnis von Arbeiten als Programmierer. Sie denken ein Projekt bis zu seinem Ende. Das klappt im digitalen Zeitalter nicht mehr. Wir müssen lernen, iterativ zu denken, wenn wir wieder innovativ sein wollen.
Der Artikel erschien ursprünglich 2018 in der perspectives #5, Themen-Special: Wandel
Bildquelle Stage: non157/iStock/Getty Images