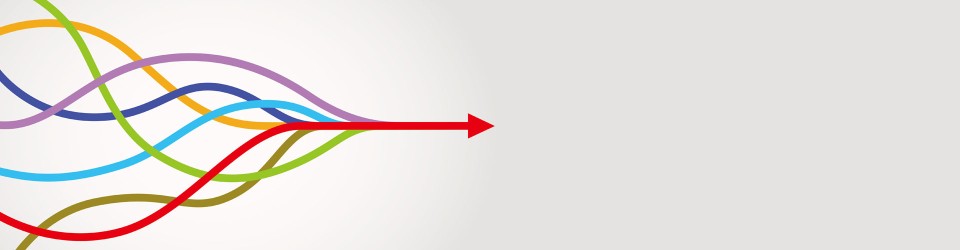Voneinander profitieren
Nahezu alle bedeutenden Pharmaunternehmen in Deutschland fördern seit einigen Jahren gezielt Start-ups mit innovativen Ideen im Umfeld der Pharmazie. Der Mehrwert für Patienten überzeugt, die Start-ups erreichen so schneller ihren Markteintritt.
31.05.2019, Günter Heismann
Viele Menschen leiden in Deutschland an chronischer Herzschwäche. Mit der richtigen Behandlung lassen sich selbst in schweren Fällen deutliche Verbesserungen erzielen. Doch die Herzinsuffizienz kann sich jederzeit wieder verschlechtern. Warnsignale sind beispielsweise Atemnot, Erschöpfung oder eine plötzliche Zunahme des Körpergewichts, die durch Wassereinlagerungen im Gewebe ausgelöst wird. Viele Herzkranke tun sich allerdings schwer damit, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.
Seit dem Dezember 2017 wird in Deutschland ein telemedizinisches System namens Mecor angeboten, das eine fortlaufende Überwachung von Herzkranken daheim in ihrer Wohnung erlaubt. Nach der Behandlung in der Klinik bekommen die Patienten eine elektronische Waage und ein kleines Gerät, das mit einem Monitoring-Center verbunden ist. Über diesen Monitor werden den Kranken nach dem Wiegen jeden Morgen fünf einfache Fragen zu ihrem Gesundheitszustand gestellt, die sie jeweils mit Ja oder Nein beantworten können.
Die Antworten und das gemessene Gewicht werden an das Monitoring-Center von Mecor übermittelt, in dem die Daten von Algorithmen und speziell ausgebildeten Krankenschwestern ausgewertet werden. Ergeben sich dabei besorgniserregende Befunde, rufen diese „Coaches“ die Patienten an und empfehlen ihnen, unverzüglich ihren Arzt aufzusuchen. So lässt sich einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz wirksam vorbeugen. Überdies können die Patienten die Krankenschwestern jederzeit anrufen, wenn sie Fragen zu ihrer Erkrankung haben. An dem Programm nehmen derzeit rund 2.000 Herzkranke teil.
Pharmaunternehmen und Start-ups im Verbund
Mecor bedeutet nicht nur einen Fortschritt in der Behandlung chronischer Herzinsuffizienz. Das Programm zeigt überdies modellhaft, welche Kooperationen heute im Gesundheitswesen Start-ups und etablierte Pharmaunternehmen eingehen. Entwickelt hat das Mecor-System die junge Firma Health Care Systems GmbH (HCSG) aus Pullach bei München; sie betreibt auch das Monitoring-Center. Unterstützt wird das telemedizinische System von Novartis Pharma aus Nürnberg, der deutschen Landesgesellschaft des Schweizer Arzneimittelherstellers Novartis, sowie der Knappschafts-Krankenkasse, die es ihren Versicherten anbietet.
Die Kooperation mit HCSG ist Teil des Förderprogramms für Start-ups, das Novartis Deutschland Anfang 2017 gestartet hat. Hierbei handelt es sich um Ausgründungen von Universitäten, Forschungsinstituten und Pharmaunternehmen, die innovative Produkte oder Dienstleistungen für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelt haben. Mit dem Programm will Novartis jungen Unternehmen eine effiziente Vernetzung im Gesundheitswesen ermöglichen, so dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich vermarkten können.
„Als einer der umsatzstärksten Pharmaanbieter in Deutschland können wir Start-ups vielfältigste Kontakte zu Ärzten, Kliniken und anderen Akteuren im deutschen Gesundheitswesen vermitteln.“
Maximilian Wambach, Head of Digital Acceleration bei Novartis Pharma
App bei Migräne
Mit seinem eng geknüpften Netzwerk konnte der Arzneimittelhersteller beispielsweise der Firma Newsenselab helfen. Das Start-up aus Berlin hat eine App entwickelt, mit der die Behandlung von Migräne unterstützt werden kann. Die Patienten tragen die Migräneattacken sowie die von ihnen vermuteten Ursachen in ein Kopfschmerztagebuch ein; ein Algorithmus analysiert dann die möglichen Auslöser der Anfälle. Auf diese Weise lassen sich systematisch die spezifischen, von Patient zu Patient ganz unterschiedlichen Trigger für Migräneanfälle bestimmen.
Wie Novartis fördern nahezu alle bedeutenden Pharmaunternehmen in Deutschland seit einigen Jahren gezielt Start-ups mit innovativen Ideen im Umfeld der Pharmazie. Im Mittelpunkt stehen dabei digitale Lösungen für das Gesundheitswesen, nicht so sehr die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Medikamente, die sehr aufwendig und langwierig ist. Und es geht nicht um millionenschwere Programme wie bei der Kooperation mit jungen Biotech-Unternehmen. Die Hilfen sind zeitlich und finanziell meist begrenzt.
Dennoch ist das Interesse der Start-ups riesig. Beim Darmstädter Chemie- und Pharmaunternehmen Merck haben sich im Herbst 565 Teams aus 68 Ländern für das Förderprogramm Merck Accelerator beworben. Sie kommen aus ganz Europa, aber auch aus Asien und Afrika. Doch längst nicht alle Kandidaten haben die Chance, unterstützt zu werden. Zehn sorgfältig ausgewählte Start-ups nehmen an der fünften Runde des Accelerators teil, die im Januar 2019 begann. Für drei Monate ziehen die Teams in das neue Innovationszentrum von Merck ein, einen architektonisch beeindruckenden Glasbau am Firmensitz in Darmstadt.

Bildquelle: Merck
Großes Interesse an Merck-Accelerator
Während dieser Zeit werden die Start-ups auf vielfältige Weise unterstützt. Die Teams erhalten jeweils einen finanziellen Zuschuss von maximal 50.000 Euro. Zudem dürfen die jungen Unternehmer die Einrichtungen des Innovationszentrums kostenfrei nutzen. In einem so genannten Maker Space können die Teams an der Entwicklung von Prototypen arbeiten. Überdies erhalten sie eine Ausbildung in Design Thinking, einer Methode zur zielgerichteten und kundenorientierten Entwicklung, die vor allem in den Informationstechnologien sehr beliebt ist. Merck bietet ebenfalls ein Training im Management von Intellectual Property an, also der Verwertung von Patenten und anderen Formen von geistigem Eigentum.
„Seit Bestehen des Programms haben wir insgesamt 40 Start-ups unterstützt“, sagt Michael Gamber, Leiter des Innovationszentrums von Merck. Zu den erfolgreichsten Teams, die an dem Förderprogramm teilgenommen haben, gehört die Firma Clustermarket aus London. Das Start-up hat Lösungen entwickelt, wie teure Laborausrüstungen besser genutzt werden können. Oft werden solche Anlagen in einem Pharmaunternehmen nicht durchgängig gebraucht. Sie könnten daher auch von anderen Firmen genutzt werden; auf diese Weise ließen sich die hohen Investitionskosten auf mehrere Schultern verteilen. Doch in der Regel haben Forscherteams große Bedenken, Fremde an ihre empfindlichen Anlagen heranzulassen. „Clustermarket hat eine Mietlösung entwickelt, zu der ein Versicherungsschutz gehört. Dies ist ein sehr spannendes Modell“, so Gamber.
Aus Förderung entstehen oft langfristige Kooperationen
Von den Förderprogrammen profitieren freilich nicht nur die Start-ups. Auch für die Pharma-Unternehmen ist die Kooperation sehr wertvoll. Für Merck bietet der Accelerator eine ausgezeichnete Möglichkeit, die geförderten Teams, ihre Arbeitsweise und ihre Innovationen genau zu studieren. Hierbei stellt sich nicht selten heraus, dass eine langfristige Kooperation für beide Seiten vorteilhaft sein kann. „In der letzten Programmrunde haben wir uns bei sechs von insgesamt zehn Start-ups dafür entschieden, gemeinsam weiter an Projekten zu arbeiten“, erläutert Gamber.
Für eine langfristige Kooperation hat Merck verschiedene Modelle. Eines besteht darin, dass das Pharmaunternehmen die Technologie eines Start-ups vermarktet. „Die Rechte am geistigen Eigentum bleiben aber in jedem Fall bei unserem Partner es sei denn das Start-up möchte seine Idee gänzlich an uns verkaufen“, betont Gamber. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das Unternehmen eine Lieferantenbeziehung zu dem Start-up aufnimmt. Merck ist dann Kunde des jeweiligen Start-ups und wird von diesem mit Produkten oder Dienstleistungen beliefert.
„Die Kooperation mit Start-ups ist für ein Unternehmen wie Merck, das 2018 sein 350-jähriges Bestehen feiern konnte, eine sehr wertvolle und bereichernde Erfahrung.“
Michael Gamber, Leiter des Innovationszentrums von Merk
Alumni-Netzwerk, um in Kontakt zu bleiben
Auch wenn sich zunächst keine Basis für eine fruchtbare Kooperation abzeichnet, bleibt Merck in der Regel in Kontakt zu den geförderten Start-ups. „Zu diesem Zweck haben wir ein Alumni-Netzwerk aufgebaut. Vielleicht ergibt sich ja in Zukunft eine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit“, erläutert Gamber. Selbst wenn nie konkrete Projekte initiiert werden, birgt das Förderprogramm für Merck Chancen, die sich gar nicht in Heller und Pfennig angeben lassen. Durch die Kooperation mit den Start-ups können Führungskräfte und Forscher lernen, wie junge Unternehmer aus ganz anderen Ländern und Kulturen arbeiten. Innovationsmanager Gamber resümiert: „Dies ist für ein Unternehmen wie Merck, das 2018 sein 350-jähriges Bestehen feiern konnte, eine sehr wertvolle und bereichernde Erfahrung.“
Das wohl umfassendste Förderprogramm für Start-ups hat hierzulande die Bayer AG gestartet. Wie Merck hat auch das Leverkusener Chemie- und Pharmaunternehmen einen Accelerator geschaffen, der Start-ups in die Lage versetzen soll, mit ihren Innovationen rascher die Marktreife zu erreichen. Die Einrichtung, 2015 gestartet, ist vor allem für junge Unternehmen aus dem Gebiet Digital Health vorgesehen. Der Hauptsitz des Accelerators befindet sich in Berlin, wo die Pharmasparte von Bayer ihre Zentrale hat.
Bayer investiert in Digital-Health-Start-ups
Dort können die Start-ups in eigenen Büroräumen an der Weiterentwicklung ihrer Technologien und Geschäftsmodelle arbeiten. Jedes Start-up erhält bis zu 50.000 Euro finanzielle Unterstützung und kann die Räume des Accelerators rund 100 Tage lang nutzen. „In dieser Zeit stellt Bayer den Start-ups erfahrene Manager als Coaches an die Seite und bietet intensives Mentoring durch externe Unternehmer an“, erläutert eine Firmensprecherin. Neben dem Accelerator in Berlin hat Bayer an seinem Standort im spanischen Barcelona einen „Coworking Space“ eröffnet, der bis zu fünf Digital-Health-Startups aufnehmen kann. Weitere Förderprogramme hat das Pharma-Unternehmen in Italien, Singapur und der japanischen Hauptstadt Tokio gestartet.
Im Unterschied zu anderen Pharmaunternehmen fördert Bayer nicht nur Start-ups, die digitale Innovationen für das Gesundheitswesen entwickeln. Gezielt unterstützt werden ebenfalls junge Firmen, die neue Wirkstoffe für künftige Arzneimittel erforschen. Zu diesem Zweck hat das Leverkusener Pharmaunternehmen einen virtuellen Forschungsinkubator geschaffen, den so genannten CoLaborator. Im Rahmen dieses Programms können Start-ups Forschungslabore an Standorten von Bayer aufbauen. Möglich ist dies nicht nur am Stammsitz der Pharmaceuticals Division in Berlin, sondern auch in Moskau, dem japanischen Kobe sowie in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien.
Welche günstige Bedingungen Start-ups im CoLaborator finden, zeigt beispielhaft der Bayer-Inkubator im historischen Stadtteil Mission Bay von San Francisco. In unmittelbarer Nähe befinden sich wichtige Forschungsinstitute sowie mehrere Dutzend Life-Science-Unternehmen, mit denen die geförderten Firmen in vielfältigster Weise kooperieren können. „Das Inkubatorkonzept bietet jungen Unternehmen Zugang zu unserer Forschungskompetenz und Infrastruktur sowie einen ersten Ansprechpartner bei der Suche nach Kooperationspartnern in der Pharmabranche“, sagt eine Sprecherin von Bayer. „Der CoLaborator schafft auf diese Weise ein ideales Umfeld, um Forschung und Innovation im Bereich der Life Sciences voranzutreiben.“
Der Artikel erschien ursprünglich 2019 in der perspectives #6, Themen-Special: Mut
Bildquelle Stage: lvcandy/DigitalVision Vectors/Getty Images